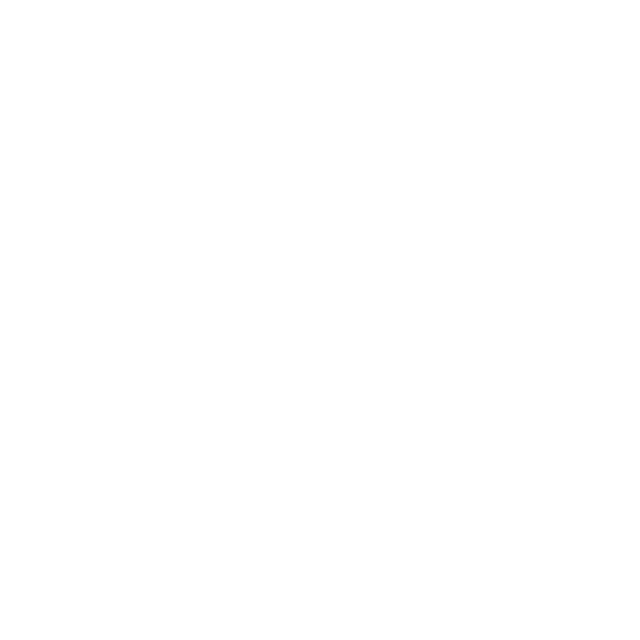No-Go-Areas in Deutschland? Darf und kann es deshalb nicht geben. Streng genommen gibt es sie auch nicht, denn das bedeutete, Menschen würden dort mit physischer Gewalt konfrontiert werden, allein schon beim Versuch, in diese Zonen hineinzugelangen.
Allerdings existieren Gegenden in dieser Republik, in denen man sich als Zugehöriger einer bestimmten Religion lieber sehr klein und unauffällig verhält, möchte man körperlich und seelisch unversehrt wieder nach Hause gelangen. Die Rede ist nicht von Moslems in Kaltdeutschland, wie es sich Asylvereine vielleicht wünschten, sondern von Juden in Berlin und einigen nordrhein-westfälischen Städten.
Mariam Lau von der Zeit (07/17) begleitete den orthodoxen Rabbiner Jehuda Teichtal eine dreiviertel Stunde durch die Sonnenallee im Berliner Stadtteil Neukölln, von der es heißt, keine Straße in der Stadt sei „arabischer“ als diese. Ich betone nochmals: nur eine Dreiviertelstunde.
Grinsen, anrempeln und eisige Blicke
Lau schildert: „An der Ecke Weichselstraße gehen wir an einem kaum achtjährigen Jungen vorbei, der eine Elektrozigarette raucht. Niemand beachtet ihn. Gleich hinter ihm kommt eine Frau in einem orangen Turban, die sich ein altes Transistorradio ans Ohr hält, aus dem in voller Lautstärke Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen dröhnt. Auch nach ihr dreht sich kein Mensch um. Aber den orthodoxen Juden, den scheinen alle zu sehen.“
Doch sie sehen ihn nicht nur, sie fühlen sich offenbar auch genötigt, zu handeln. So „kurbeln zweimal Leute ihre Autofenster herunter und brüllen dem Rabbi etwas hinterher. Yahoud, ‚Jude’, ist das einzige Wort, das man im Straßenlärm versteht. Zwei jüngere Männer gehen an ihm vorbei, der eine dreht an seiner Gebetskette. Sie sagen nichts. Doch ihre Blicke sind eisig. Ein Mann rempelt Teichtal an, eine Frau spuckt im Vorbeigehen auf die Straße – ob aus Versehen oder mit Absicht, ist beide Male nicht ganz klar. Leute hupen an der Ampel, grinsen ihn an, fühlen sich gedrängt, seine Gegenwart irgendwie zu kommentieren.“
Dann erzählt Teichtal der Journalistin über einen Vorfall in der Schule seiner jüngsten Tochter. Diese sei kürzlich bleich vor Schreck nach Hause gekommen. Im Sportunterricht hatte ein moslemischer Mitschüler gesagt, er wolle keine Juden in seiner Mannschaft, und niemand habe protestiert. „Sie war plötzlich nicht mehr ein Mädchen von vielen, sie war eine Jüdin. ‚Was soll ich machen, Papa?’, hat sie Teichtal gefragt. Was rät er ihr und wie regiert er, wenn er auf Antisemiten trifft? ‚Gar nichts. Tu gar nichts. Ignorier sie.’“
Gerade unangenehme Fragen müssen gestellt werden
Das allein ist schon schrecklich genug. Wer das Beschriebene nun konsequent weiter denkt, wird auf ein paar unangenehme Fragen stoßen:
Könnte auf böse Blicke und Rempeleien irgendwann noch Schlimmeres folgen?
Erst recht, wenn die Zahl derer, die aus einer Kultur stammen, in denen Antisemitismus und Israelhaß mit der Muttermilch aufgesogen wird, drastisch steigt?
Könnten dann nicht auch andere Gruppen, etwa Christen oder Buddhisten, ins Visier geraten?
Vielleicht werden wir von solchen und ähnlichen Vorfällen dann auch flächendeckend in der Bundesrepublik lesen?
Obwohl dies alles bekannt wäre, aber auch Einwanderer ohne deutschen Paß wahrscheinlich bald auf die ein oder andere Weise wählen dürfen, könnte dann auf politischer Ebene gegen solchen gruppenspezifischen Haß etwas unternommen werden?
Und die Medien? Würden Medien, die künftig allesamt etwa so aussehen könnten, dagegen anschreiben?
Kann es sein, daß die deutsche Politik auf Hinweise jüdischer Verbände nicht mehr so reagiert, wie sie das noch vor 15 Jahren tat?
Gerade unangenehme Fragen müssen gestellt werden. Und: Ob Ignorieren langfristig eine gute Überlebensstrategie ist, bezweifle ich.