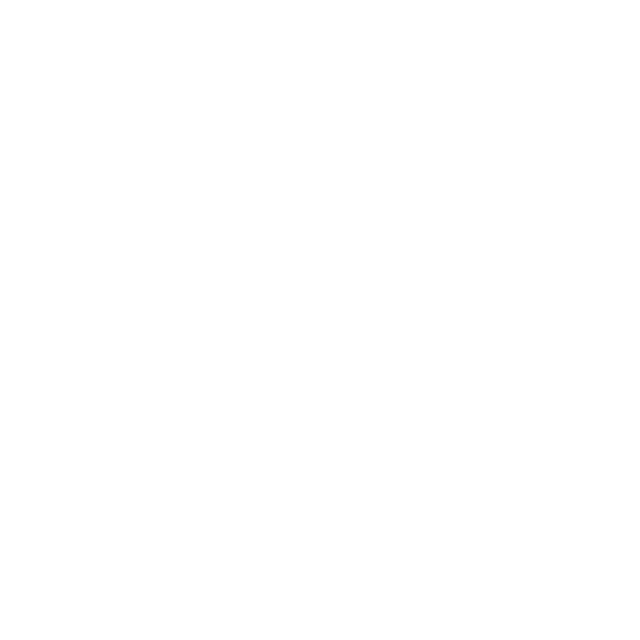Wer gegen 18 Uhr am Hohenzollerndamm mit dem Rennrad startet, um einmal quer durch Berlin zu strampeln, weiß, worauf er sich einläßt. Doch es sind nicht nur Negativerfahrungen, auf die man später zu Hause zurückblicken kann. Man lernt im Schnelldurchlauf verschiedene Kulturen kennen, wie es so wohl nur in Deutschlands Hauptstadt Bundeskloake möglich ist.
Die wichtigste Straße in Wilmersdorf führt schnurstracks Richtung Osten. Zahlreiche Firmen, Hotels und mehrsprachige Schulen prägen den Stadtteil. Dementsprechend gekleidet sind auch die Frauen und Männer auf ihren teuren Fahrrädern: Fahrradschuhe im Straßenlook, hochgekrempelte Hemdsärmel, die Hosenbeine mit einer grell leuchtenden Hosenklammer zusammengebunden, die Radtasche optisch passend zum Drahtesel in Schwarz-Grau.
Doch Radfahrer sind nicht das Problem, kein Hindernis, schließlich fahren sie auf dem Radweg und ich auf der Straße. Und dort trifft man auf verschiedene Typen von Autofahrern.
Erstens: Der Neider. Er gehört zu jener Sorte, die schnellstmöglich nach Hause will und es nicht akzeptieren kann, wenn andere, nichtmotorisierte Menschen mit ihm die Straße teilen und sogar schneller sind als er. Vor der Ampel fährt er rechts ran, damit ich nicht überholen kann. Dennoch weiß er: Ich werde ihn bei Grün überholen. An den Autos kann er sich schließlich nicht vorbeischlängeln.
Zweitens: Der Tagträumer. Er hat keine zeitlichen Sorgen. Er fährt, weil er fahren muß. Ob und wann er ankommt, ist ihm nicht so wichtig. Die Tachonadel seines Fahrzeugs zeigt höchstens 40 Kilometer die Stunde an – für mich ideal, um im Windschatten in die Pedal zu treten.
Drittens: Der Hipster. Ja, es gibt auch welche dieser Sorte, die mit dem Auto unterwegs sind. Er traut sich auch auf einer zweispurigen Fahrbahn nicht, Dich zu überholen. Schließlich könnte er in einen Unfall verwickelt werden und überhaupt schämt er sich, wenn er mit vier statt zwei Rädern unterm Sitz unterwegs ist.
Viertens: Der Berliner. Von seinesgleichen gibt es nur mehr wenige. Die zahlreichen Neophyten aus Schwaben, Mecklenburg und Vorpommern sowie jüngst auch aus den arabischen Ländern drängen ihn immer weiter zurück. Für den Typ Berliner bin ich als Rennradfahrer mit meinem neonfarbenen Trikot eines UCI-Worldteams wildfremd, ja exotisch. Er kennt seine Stadt am ehesten vom Blick aus einer der Eckkneipen heraus, die immer weniger werden. Sport oder gar Rennräder interessieren ihn nicht.
Fünftens: Der Eifersüchtige. „Ich raffe mich morgen auf, und fahre auch mit dem Rad zur Arbeit!“ Das denkt der Eifersüchtige während er Dich überholt und mitunter auch anfeuert. Sein Gedanke wird sich nicht in den Alltag manifestieren. Dafür kauft er seinem Sohn fürs nächste Weihnachtsfest ein teures Fahrrad.
Zugegeben: Autofahren im individualverkehr-feindlichen Berlin ist ohnehin nicht leicht. Da kann ein Rennradfahrer auf der Hauptstraße ganz schön nerven. Doch was bei der Fahrt durch Berlin mit dem Auto völlig untergeht und sich für den Rennradfahrer lohnt, ist die Vielfalt an Kulturen, die in dieser Stadt etabliert und visuell, akustisch und olfaktorisch wahrnehmbar sind.
Spätestens ab dem U-Bahnhof Herrmannplatz ändert sich das Straßenbild deutlich. Die Frauen tragen kürzere Haare oder bedecken sie mit einem Kopftuch. Die Männer sind in zahlenstärkeren Gruppen unterwegs. Während in Wilmersdorf keine Musik aus Läden tönt, wechselt sie hier nahezu an jeder Straßenecke. Meist ist es arabischer Pop oder eine andere orientalische Klangart. Der Döner- und Falafelgeruch läßt wenigstens kurz vergessen, daß man im dichten Feierabendverkehr unterwegs ist.
Eine Querstraße weiter ist der Spuk vorbei. Richtung Stadtautobahn geht’s leicht berghoch. Die ameisenhaufengleichen Menschenmassen existieren hier scheinbar nicht. Dafür ein Elektroradfahrer. Sein Motor liefert ihm die entscheidenden Watt mehr. Er fährt auch bergan seine 30 Kilometer die Stunde. Der Schwindler vergißt aber: Im Flachen stagniert sein Gefährt bei 35 km/h. Ohne Gegenwind komme ich dort auf 40 Sachen. Klar, das Kuota-Karbonrad wiegt weniger als acht Kilogramm, seines mindestens 20, aber treten muß ich trotzdem allein.
Die Autobahn wirkt wie eine in die Tiefe gebaute Mauer. Vor ihr liegt die Innenstadt mit all den bunten, schrillen und lauten Signalen. Dahinter wartet die Ruhe, nach der sich das Sportlerherz sehnt: endlich kein Aufpassen mehr auf aus Parklücken hervorpreschenden Kleinwagen; endlich keine Rücksicht mehr auf andere Stadtradfahrer, die sich auf die Hauptstraße verirrt haben; endlich keine intensiven Gerüche mehr in Nase und Mund.
Endlich Ruhe? Weit gefehlt! Während ich innerhalb des Autobahnrings als Radfahrer der King war, bin ich draußen der Idiot. Ab hier beginnt Deutschland, das lieblich penetrante Spießerland. Anders als etwa in Italien hupen Dich Autofahrer aus, weil Du mit dem Rennrad auf der Straße und nicht auf dem holprig-gepflasterten Radweg fährst. Du zeigst die Faust oder den Mittelfinger. Sie zeigen zurück. Anhalten werden sie trotzdem nicht.
Die Häuser werden weniger, die Gärten mehr. Der Wald leuchtet grün. Endlich liegt Berlin im Rücken. Bis nach Hause sind es noch ein paar Kilometer. Ich mache ein Kreuzzeichen. Wieder eine Rennradtour durch die Hauptstadt überstanden. Und wieder gewisser: Deutschland braucht die Grünen nicht.