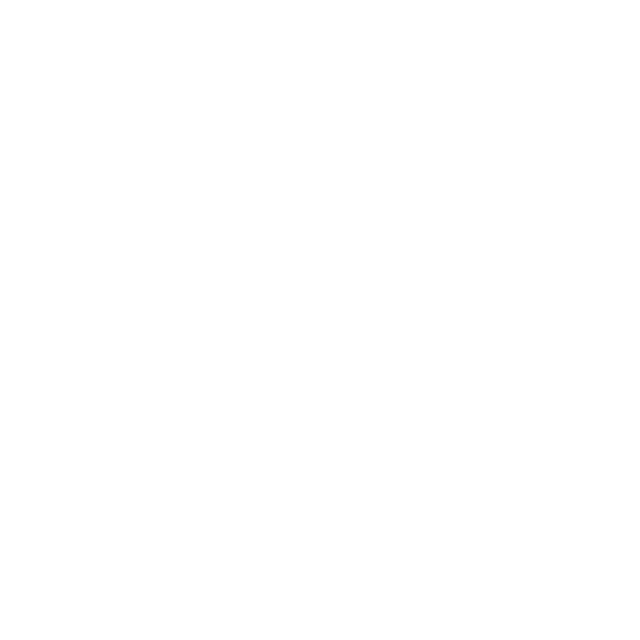Politiker und Parteien linker wie rechter Couleur reagieren auf die zunehmend vernetzte und komplexer werdende Welt mit Forderungen nach illusorischer Reduktion und Angeboten an vermeintlicher Vereinfachung. Besonders sogenannte Populisten gelang es damit in der jüngeren Vergangenheit, in der Wählergunst zu steigen. Auch in Deutschland. Der Kopf des Rechtsaußenflügels der AfD, Björn Höcke, konstatierte im vergangenen Jahr in einem Video: „Ich bin der festen Überzeugung, dass der global-kapitalistische Ansatz uns als Partei in eine Sackgasse führen würde. (…) Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck, die Wirtschaft hat dienenden Charakter, im Mittelpunkt muss immer der Mensch stehen. Wir wollen keine kalte Partei, wir wollen keinen kalten Kapitalismus, wir wollen eine ökologische, eine soziale, wir wollen eine menschliche Marktwirtschaft.“ Im aktuellen Grundsatzprogramm der Grünen heißt es: „Die Wirtschaft dient den Menschen und dem Gemeinwohl, nicht andersherum.“
Es sei notwendig, „grundlegend anders zu wirtschaften: chancen-, ressourcen- und geschlechtergerecht“. Dies bedeute „einen Wandel hin zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft innerhalb klarer Leitplanken und mit Gemeinwohlorientierung“. Der Markt dürfe nicht das alleinige Organisationsprinzip sein. „Im Wettbewerb soll erfolgreich sein, wer übergeordnete gesellschaftliche Ziele nicht konterkariert, sondern befördert.“ Und „Unternehmer*innen dürfen nicht gezwungen werden, sich zwischen einem wirtschaftlich erfolgreichen Weg oder einer sozialen und ökologischen Ausrichtung des Unternehmens zu entscheiden. Wirtschaftliche Aktivität muss sich an langfristigen Zielen und gesamtgesellschaftlichem Wohlstand ausrichten.“ Das Primat der Politik gelte auch gegenüber Wirtschaft und Kapital. Den etatistischen Furor plakatierte Co-Parteichef Robert Habeck, als er in einem Interview sagte, die Menschen wären überfordert, müssten sie sich bei jeder Kaufentscheidung politisch korrekt verhalten. Damit es dennoch „möglichst viel korrektes Verhalten“ gebe, brauche es die Politik. Solche Aussagen dokumentieren nicht nur eskalierten Idealismus, überlegenswert ist außerdem die These abnehmender wirtschaftlicher Bildung bei steigendem Wohlstand.
Die Notwendigkeit des Wirtschaftens
Die Formulierung der „dienenden Wirtschaft“ etwa ist bei Besinnung auf den Zweck und die Notwendigkeit unseres Wirtschaftens überhaupt ein sinnfreier Pleonasmus. Dieses ist die Konsequenz unserer unvollkommenen Existenz und theoretisch unendlichen Bedürftigkeit und unseres mit knappen Ressourcen ausgestatteten Planeten. Lebten wir im Schlaraffenland, bräuchten wir nicht wirtschaften. Es gibt verschiedene Wege, das soziökonomische System zu organisieren. Und die Menschheit hat auch schon einige ausprobiert. Als die effizienteste, freiheitlichste und anpassungsfähigste stellte sich bislang die kapitalistische Marktwirtschaft heraus. Sie liefert die relevanten Preissignale, an denen Produzenten und Konsumenten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihr wirtschaftliches Handeln ausrichten. Auch moderne Hochleistungsrechner und Big Data können den alten linken Traum einer zentralen Planungsstelle, die ein globales Wirtschaftssystem steuern kann, nicht wahr werden lassen – und die Aussicht, dass dieses System in nicht allzu ferner Zukunft die planetaren Grenzen überwinden könnte, lässt ihn gänzlich platzen.
Die kapitalistische Marktwirtschaft basiert auf Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft sowie Einheit von Risiko und Haftung. Dieser kalte Kapitalismus, um den Kampfbegriff der Gegner dieses Systems aufzugreifen, steht seit jeher unter Attacke. Die Waffen, die auf ihn gerichtet sind, wurden freilich angepasst und ausgetauscht. Vor allem wird heute an die „gesellschaftliche Verantwortung“ der Unternehmen appelliert. Unter dem Schlagwort Environmental Social Governance (ESG) hat sich neben der politischen Dimension dieses Begriffs auch eine neue Kategorie in der Finanzindustrie gebildet. Unternehmer und Unternehmen, so lautet die Devise, sollen sich ihrer Verantwortung mit Blick auf Gesellschaft, Umwelt und Betriebsführung bewusst sein und entsprechend handeln.
Der Ansatz und die Debatte darum sind jedoch nicht neu. Unter dem Titel „The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits“ veröffentlichte der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman vor knapp über 50 Jahren im New York Times Magazin einen Aufsatz, in dem er seine Shareholder-Doktrin skizzierte, nach der die primäre Verantwortung des Firmenmanagements gegenüber den Eigentümern, also den Aktionären, besteht und nicht im Erfüllen sich wandelnder sozialer Ziele. Dafür erhielt Friedman scharfe Kritik, auch von bekannten Managern, die sich dem Stakeholder-Value-Ansatz verschrieben hatten. Dabei propagierte der Ökonom keinen Raubtierkapitalismus. Er betonte jedoch, einzige soziale Verantwortung der Unternehmen sei es, „die Ressourcen für Aktivitäten zu nutzen, die möglichst viel Gewinn erbringen, unter Einhaltung der Spielregeln, d.h. sich im offenen und freien Wettbewerb zu engagieren, ohne Täuschung und Betrug“. Die „Doktrin der sozialen Verantwortung“ hingegen, warnte Friedman weitsichtig, führe notwendigerweise in die sozialistische Sichtweise, „dass über politische Verfahren und nicht über den Marktprozess über die Verwendung knapper Ressourcen entschieden werden sollte“.
Raus aus der Defensivhaltung
In der Autoindustrie und in vielen anderen Branchen geschieht dies mehr oder minder ausgeprägt auch bereits in der westlichen Welt. Machbarkeitsglaube und die „Anmaßung von Wissen“ (Friedrich August von Hayek) haben in der Politik Hochkonjunktur. Und neu ist, dass sich ein relevanter Teil der Linken mit dem Kapital verbunden zu haben scheint. Auffällig ist das vor allem beim Klimaschutz und der Gendergerechtigkeit. Der US-Kolumnist Ross Douth bezeichnete dieses Verhalten 2018 in der New York Times als woke capitalism. Wenn sich das Management mit Linken herumschlagen muss, die keine Massenstreiks organisieren und höhere Löhne fordern, sondern stattdessen auf die Verwendung des Gendersternchens pochen, kommt ihm das sicher eher zugegen und ist noch dazu deutlich günstiger.
Doch die Unternehmen begeben sich damit in eine Defensivhaltung, die aus politischer Naivität resultiert und aus der sie, je weiter sie gehen, schwerer wieder herauskommen. Greenpeace-Aktivisten stahlen Ende Mai mehr als 1.000 Autoschlüssel des VW-Konzerns, um auf die „Klimakrise“ aufmerksam zu machen und für den schnelleren Umstieg des Automobilherstellers auf Elektromobilität zu demonstrieren. Wer einen Unternehmenssprecher um eine Stellungnahme bat, konnte den Eindruck gewinnen, der Konzern wolle den Ärger über den Diebstahl mit Floskeln á la „man sei zu kritischem Dialog bereit“ und „Klimaschutz ist ohnehin ein zentrales Thema der Konzernstrategie“ übertünchen. Die Kommunikationsstrategie war klar: Man wollte sich in den ersten Tagen zurückhalten und sich auf keinen Fall öffentlich mit den Klimaschützern anlegen. Erst einen Monat später, als sich der mediale Hype um die Protestaktion längst gelegt hatte, stellte VW einen Strafantrag.
Vielleicht wollte VW in der Öffentlichkeit nicht als Gegner einer Klimaschutzorganisation wahrgenommen werden. Vielleicht glaubte die Konzernführung, die Aktion sei medial sowieso ins Leere gelaufen, da VW sich voll und ganz der Elektromobilität verschrieben hat und mittlerweile zu den führenden europäischen Herstellern zählt – und dabei von generösen und immer wieder verlängerten Subventionsprogrammen profitiert. Vielleicht aber unterschätzt die Unternehmensleitung schlicht seine Kritiker. Immer stärker wird die Gruppe jener Klimaschützer, die nicht nur ausschließlich batteriebetriebene Elektroautos wollen, sondern das Verbot jeglicher privater Fahrzeuge fordern – und das kann nicht im Sinne von VW sein.
Wenn nicht mehr Konsumenten entscheiden, welches Produkt sich durchsetzt, sondern die Regierung oder eine Lobbyorganisation, dann ist das bisherige soziökonomische System in Schieflage geraten – und dann ist die Zeit für Unternehmer gekommen, sich gesellschaftlich zu engagieren, aber anders als bislang geglaubt. Und Gegenwehr ist möglich. Das bewies der YouTuber Kolja Barghoorn, der unter dem Namen „Aktien mit Kopf“ einen reichweitenstarken Kanal über Finanzthemen betreibt. Er veröffentlichte an Ostern zwei Videos, in denen er sich kritisch mit den Enteignungsforderungen von „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ („DW enteignen“) auseinandersetzte. Zudem forderte er seine Follower auf, der Initiative freundlich ihre Meinung zum Thema sozialistischer Wohnungspolitik mitzuteilen. Dann geschah etwas Bemerkenswertes: Bereits kurze Zeit später hatte ein entsprechendes Werbevideo von „DW enteignen“ dreimal so viele negative wie positive Bewertungen. Nicht nur das: Die Enteignungskampagne sah sich gezwungen, den Kommentarbereich zu schließen.
Auch auf Instagram legten sich die Privatanleger mit der Initiative an, was deren Sprecher dazu veranlasste, diese als „Abschaum und Bodensatz der Immobilienbosse“ zu bezeichnen. Und das, obwohl sich linke Kampagnen wie „DW enteignen“ der moralischen Vormachtstellung in sozialen Medien sonst sicher sein können. Wenn Pressure-Groups ihre Interessen und Politiker ihre Politik auf Kosten von Unternehmen durchzusetzen versuchen, müssen letztere den Fehdehandschuh ergreifen, denn bis auf wenige Ausnahmen, die sich mit den je aktuell tonangebenden Organisationen auf korporatistische Weise arrangieren können, verlieren sie, auch wenn sie sich den hehren Zielen unterordnen. Eine Meta-Analyse von Katja Rost (Universität Zürich) und Thomas Ehrmann (Universität Münster) kam 2015 zu dem Schluss, dass sich Corporate-Social-Responsibility-Maßnahmen (CSR) für Unternehmen nicht auszahlen, allenfalls gewinnneutral sind und die ausgewerteten Arbeiten beispielsweise aufgrund von „reporting bias“-Fehlern zugunsten von CSR schöngerechnet worden waren.
Anmaßung von Wissen
Schließlich tritt noch ein weiteres, grundlegenderes Problem auf, wenn Regierungen ihre Ziele an Unternehmen delegieren und sie stark regulieren: das des mangelnden Wissens. Der Sozialphilosoph, Ökonom und Nobelpreisträger Hayek machte darauf bereits 1945 in seinem Aufsatz „The Use of Knowledge in Society“ aufmerksam. Eine zentrale Planung, die auf statistischen Informationen beruhe, könne die Umstände von Zeit und Ort nicht direkt berücksichtigen. Mit anderen Worten: Selbst wenn Unternehmen sich ESG-konform beispielsweise dem Ziel anschließen, bis 2050 CO2-neutral zu wirtschaften, wissen sie nicht, ob sie das, was sie jetzt dafür tun, dem Ziel am Ende wirklich dienlich ist oder ihm gar zuwiderläuft. Die Marktwirtschaft ermöglicht hingegen eine dezentrale Planung vor Ort und kann spontane Ordnungen entfalten, wie Hayek im Zusammenhang seiner liberalen Grundsätze notierte. Die Nichtvorhersagbarkeit bestimmter Ereignisse ist auch durch Big Data nicht erfass- und behebbar.
Zweierlei gilt es zu beachten: Wissen ist immer vorläufig, weshalb der freie Diskurs notwendig ist. Die freiheitliche Demokratie steht genauso wie die freiheitliche Wirtschaftsordnung unter Druck. Beides steht in einem Zusammenhang, wie auch der Staatskapitalismus und die gesellschaftlichen Einschränkungen chinesischer Prägung zeigen. Freie Unternehmer sollten, nein, müssen sich in Zeiten von Social Media und den inneren und äußeren Angriffen auf das freiheitliche System für dieses System engagieren. Sie sind es, die der Komplexität und den (spontanen) Herausforderungen – die Corona-Pandemie hat es gezeigt – erfolgreich begegnen können. Der Staat hat die Rolle, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Unternehmen in ihrem Gewinnstreben alle relevanten Kosten miteinbeziehen und die entsprechenden Eigentumsrechte durchsetzen – nicht mehr und nicht weniger.