Keine einzige Wolke trübt den Blick auf den Himmel über dem Bozner Bahnhof. Ein Geschäftsmann hetzt mit schweißnasser Stirn zwischen die Bahnsteige. Touristen suchen im Schatten der Bahnhofsgebäude Schutz vor der Sonne. Das Quecksilber steht bei 37 Grad Celsius. Einige Meter vor dem Eingang in die Haupthalle sitzt ein dunkelhäutiger Mann mit einem blauen „Italia“-T-Shirt. Er spricht mit zwei Beamten der italienischen Staatspolizei. Im Vorbeigehen entnehme ich dem Gespräch das Wort documenti. Ich gehe weiter. Das erstes Ziel sind zwei gelangweilt wirkende Ordnungshüter.
Im Bahnhofsgebäude stehen die zwei Staatspolizisten vor der Bar mit 60er-Jahre-Charme. Sie gehören zu der Gruppe Polizisten, die für die ankommenden Flüchtlinge eingesetzt wurde. Wie die Situation im Vergleich zum Frühjahr ist, will ich wissen. „Wir sind leider nicht befugt, Ihnen solche Fragen zu beantworten. Wir haben unseren Auftrag. Bei Fragen gehen Sie bitte in die Quästur“, antwortet einer der beiden höflich. Nichts zu machen.
Seit mehreren Monaten patrouillieren Polizisten der Quästur Bozen am Bahnhofsgelände. Sie wurden eingesetzt, um die ankommenden Flüchtlinge und illegalen Einwanderer zu erfassen. Zu Hochzeiten durchlaufen laut Landesregierung 150 bis 200 Flüchtlinge pro Tag den Bahnhof. „Die Flüchtlinge am Bozner Bahnhof kommen in der Regel in Gruppen zwischen 30 und 60 Personen an, sind selbstständig unterwegs und wollen so schnell als möglich Richtung Norden weiterreisen“, berichtete die zuständige Soziallandesrätin Martha Stocker Ende April. Seither hat sich die Situation nicht verändert.
Der erste Blick außerhalb des Bahnhofs fällt auf den kleinen begrünten Platz. Mehrere illegale Migranten, aufgeteilt in kleine Menschentrauben, sitzen auf und um Bänke herum. Die eklige Hitze des Bozner Kessels macht auch ihnen sichtlich zu schaffen. Direkt vor dem Landtagskomplex auf der gegenüberliegenden Straßenseite sitzt Arhni. Er hat als Kind gemeinsam mit seinem Vater sein Heimatland Marokko verlassen. Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Zusammen mit seinem ebenfalls aus Marokko stammenden Freund, der seinen Namen nicht verraten will, sitzt er auf der Bank vor jenem Gebäude, in dem debattiert und entschieden wird, was mit Zuwanderern wie ihm passiert. Arhni kam Anfang der 2000er auf eine italienische Schule, Deutsch kann er auch heute nicht. Das ist nicht verwunderlich. Daß es in Italien eine deutschsprachige Minderheit oder gar eine Sonderautonomie Südtirol-Trentino gibt, wußte Arhni nicht. Auch die jüngsten Zahlen des Landesstatistikamtes zeigen, daß Ausländer meist in italienischsprachige Schulen geschickt werden. Während sich die Zahl der Schüler mit ausländischer Herkunft in deutschen Schulen auf 9,5 Prozent beläuft, ist die Quote derselben in italienischen Schulen mit 21,6 mehr als doppelt so hoch.
„Ohne Deutsch kann man hier nichts machen“, moniert der junge Mann mit dem Dreitagebart. Weiter südlich oder gar im Mezzogiorno wollte sein Vater allerdings nicht bleiben. „Dort ist die Luft ganz anders“, sagt er mit ernster Miene und meint damit nicht nur die Temperaturunterschiede im Vergleich zur Alpenregion. „Dort sieht man viel mehr Leute wie die hier“ und zeigt auf ein Dutzend Männer mit Migrationshintergrund, die einige Meter entfernt von uns um eine Parkbank herumsitzen. „Leute, die keine Arbeit haben und nichts anzufangen wissen mit dem Tag.“
Seit mehr als zwölf Jahren lebt Arhni nun in Südtirol. Dort, so kurz vor dem letzten Hindernis nach Deutschland, den Brennerpaß, ließ sich sein Vater nieder. Warum es nicht weiter nach Norden ging? „Weil er Arbeit fand. Wieso hätten wir weiter nach Deutschland oder Skandinavien ziehen sollen, nachdem mein Vater Arbeit bekommen hatte? Die Menschen gehen dorthin, wo sie Arbeit finden“, antwortet Arhni. Auch er habe nach der Mittelschule eine Arbeit gefunden, das sei aber schon einige Jahre her, sagt er. Zurzeit gehe er keiner geregelten Tätigkeit nach, erzählt Arhni
Auf die seit Dezember vergangenen Jahres eintreffenden illegalen Migranten blickt er skeptisch. „Noch vor vier Jahren mußten wir für ein Zimmer im Hotel Alpi 110 Euro zahlen und jetzt bekommen die es gratis“. Ob die Summe stimmt, ist nicht mehr überprüfbar, denn das Nobelhotel in der Südtiroler Straße wurde vom Innsbrucker Immobilienmogul René Benko zum Flüchtlingsquartier umfunktioniert. Der Marokkaner kann nicht verstehen, warum den Migranten jetzt kostenlose Unterkünfte und Verpflegung zur Verfügung gestellt werden, ihm und seiner Familie damals jedoch nicht. „Neulich habe ich mitbekommen, wie es einen Aufstand im Alpi gab, weil die Bewohner kein Gratis-Wifi hatten“, berichtet Arhni sichtlich verärgert.
Mit den „Neuen“, wie er sie nennt, habe er oft zu tun. Dem Grundtenor der Medienberichte, wonach fast alle von ihnen weiterreisen wollten, stimmt der junge Mann zu. Laut Soziallandesrätin Martha Stocker wollen gar nur zwei von den über 150, die pro Tag ankommen, in Südtirol bleiben. „Was würden Sie tun?“, fragt Arhni rhetorisch, „in dem Land bleiben, wo Sie Arbeit haben, oder in das Land zurückkehren, wo Sie nichts haben?“ Die Arbeit gibt es, so der Marokkaner, in Deutschland oder Skandinavien. Deutschland stehe für Wohlstand und Arbeit. Italien und Österreich sind nur „Ostacoli“, Hindernisse, auf dem Weg dorthin. Die 3.000 Meter hohen Berge und Pässe manifestieren dieses Alpen-Hindernis.
Auf der anderen Seite des Alpenhauptkammes, in Innsbruck, arbeitet Marius Meisinger.Im Minutentakt klingelt das Telefon des stellvertretenden Leiters der Fremdenpolizei Tirol. Obwohl im Westen Österreichs vom großen Zuwandererstrom über die Balkanroute nichts spürbar sei, hat Meisinger alle Hände voll zu tun. Auch er bestätigt, daß der Großteil der Migranten weiter nach Deutschland oder in die skandinavischen Länder möchte. „Wir haben täglich Aufgriffe. Wir fahren mit den Italienern und den Deutschen die trinationalen Streifen.“
In internationalen Reisezügen, die vorrangig als Eurocity-Züge zwischen Verona und München verkehren, kontrollieren die Beamten Pässe. Im Rahmen dieser länderübergreifenden Kontrollen werden täglich Personen nach Italien rücküberstellt, die illegal unterwegs sind. Dasselbe Verfahren wird zwischen Deutschland und Österreich angewandt, erklärt Meisinger. „Es gibt aber kein fixes Regelwerk bei Grenzübersetzungen, das ist immer lageabhängig.“

Funktioniert diese Methode? Zeigen die Kontrollen in Zügen und auf die gen Norden verlaufenen Straßen Wirkung? Selbst der Fremdenpolizist muß zugeben: „Einen derartig gigantischen Migrationsstrom auf Dauer, jede Person rückwirkend aufzuhalten, ist weder von der österreichischen Polizei noch sonsteiner Polizei möglich.“ Wer das Hindernis Österreich überwinden will, schafft es früher oder später auch. „Es gibt keine Grenzkontrollen und es stimmt, es gibt Zweitaufgriffe, es gibt sogar Drittaufgriffe, weil nicht lückenlos kontrolliert werden kann und nicht lückenlos kontrolliert werden darf“, bestätigt Meisinger.
Zurück in Bozen. Nur wenige Hundert Meter südwestlich vom Hauptbahnhof. Auch Francesco Bianco, Pressesprecher der Bozner Quästur, weiß um das Problem mit den Kontrollen in den Zügen. „Unsere Aktivität sind Kontrollen zur Identifizierung, nichts weiter. Wenn die Identitätskontrolle vorbei ist, kann die Person machen, was sie will.“ Der 30jährige Neapolitaner lacht herzhaft auf, als er die Frage hört, ob es Pläne für eine andere, bessere Handhabung im Umgang mit den Flüchtlingsströmen gibt. „Da müssen Sie schon die Regierung in Rom fragen.“.
Auf dem Weg zurück zum Bahnhof sitzen Arhni und sein unbekannter Freund immer noch auf der Bank vor dem Landtag. „Vai a casa? – Gehst du nach Hause?“, fragt er mich. Was glaubt er, wie viele Flüchtlinge wieder nach Hause gehen werden? „Ich schätze höchstens zehn Prozent, nicht mehr“ und wischt sich den Schweiß von der Stirn.
Anmerkung: Diese Reportage hatte ich Ende 2015 für einen Jungautorenwettbewerb geschrieben, der leider abgesagt wurde. Auf meinem Blog ist er erstmals veröffentlicht.
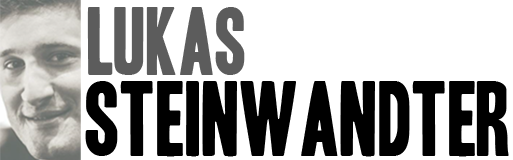



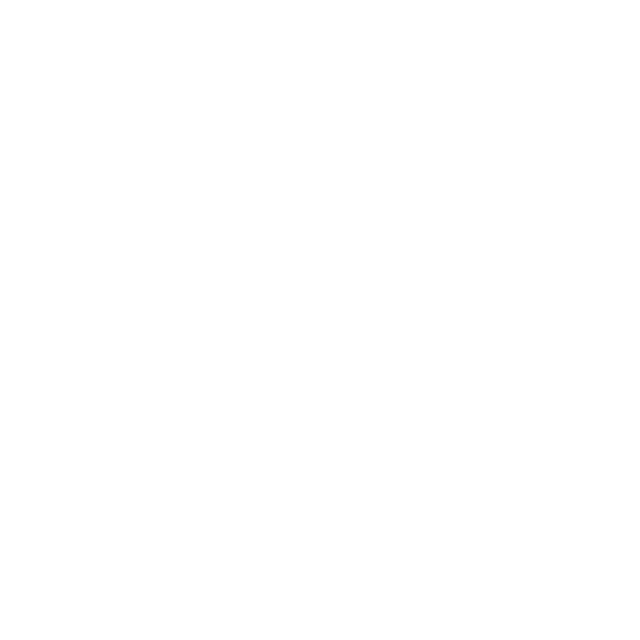
Tolles Stück! Man fühlt sich wirklich hineinversetzt in’s schöne Süd-Tirol! Verstehe nicht warum der Bericht nicht veröffentlicht wurde.
Diese Angeberei von euch Rechten kotzt echt an. Wieder einmal sind hier alle Journalistischen Regeln verletzt worden. Und sowas nennt sich „Journalist“. Dass ich nicht lache…
Lieber Herr „Innerhofer“, Sie können hier weiter unter falschen Namen (dem meines Kollegen, ich verstehe Ihre Anspielung) schreiben. Ich genehmige jeden Kommentar, so lächerlich er auch sein mag.