Asylsuchende und ihre Integration sind seit einem Jahr unangefochten Thema Nummer eins in Deutschland. Es wird viel geredet über sie – und noch mehr geschrieben. Doch die wenigsten reden mit ihnen. Ich hatte vor kurzer Zeit die Gelegenheit mit einem jungen Mann zu sprechen, der in einer Asylunterkunft in Berlin lebt. Nicht als Journalist, sondern als Privatmann. Er war gerade auf dem Heimweg einer Bahnhofskneipe, in der sich regelmäßig mehrere Asylbewerber aufhalten. Er hörte arabische Popmusik über seine Handylautsprecher. Es war kurz vor 1 Uhr.
Seine Musik machte er auf meine Bitte hin sofort aus. „Ich will hier nicht auffallen“, zeigte das Handydisplay an. Handydisplay? Ja, denn mein Gegenüber konnte weder Deutsch noch Englisch. Er stamme aus Libyen, spreche Arabisch und Französisch, betonte er. Seit Anfang des Jahres sei er in Deutschland. Gut, dachte ich, unsere Sprache wird er schon noch lernen.
Deutsch lernen? Fehlanzeige!
Falsch. „Kein Deutschlehrer“, übersetzte das Handy. Auch auf Nachfrage hin unterstrich der Libyer, es komme weder ein Pädagoge in die privat geführte Asylunterkunft, noch werde er irgendwo hingebracht, wo er unsere Sprache lerne. Natürlich weiß ich nicht, ob mir der junge Mann die Wahrheit sagte. Deutsch sprechen konnte er jedenfalls nicht.
Ich begleitete den Libyer bis zur Unterkunft. Und siehe da: Diese liegt an einem Fluß im Süden Berlins. Eine schicke Gegend, die sich der durchschnittliche Berliner nicht leisten kann. Wie ich am nächsten Tag in Erfahrung bringen konnte, diente das Gebäude vor der merkelschen Einladung an die Armen dieser Welt als Hotel.
Wie geht es weiter?
Da stellt sich mir die Frage: Wie geht es mit dem jungen Libyer weiter? Ich fragte ihn, ob er in seine Heimat zurück möchte, wenn sich die Lage stabilisiert und Normalität einkehrt. Nein, gestikuliert er mit dem Zeigefinger, „Germany is good“. In Libyen habe er nichts und in Deutschland gäbe es alles, was man braucht. Erhielte der junge Mann in naher oder ferner Zukunft tatsächlich Arbeit, müßte er seine Unterkunft aus eigener Tasche zahlen. Zu einer Wohnung in dem Stadtteil, wo die Asylunterkunft liegt, würde es nicht reichen.
Welchen Anreiz soll jemand wie er haben, um arbeiten zu gehen und zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen? Keinen. Ich bin mir sicher, zum Großteil wird es unmöglich sein. Jemand, der in seiner Heimat nicht viel hatte, plötzlich in einer nobleren Berliner Gegend mit Flußblick wohnt; das alles, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen; dem wird man nicht mehr zu einem normalen Arbeiterleben in der Steuerhölle Deutschland bringen.
Dem jungen Mann trifft indes keine Schuld. Er handelt rational. Völlig irrational jedoch ist die Anreiz- und Willkommenspolitik der regierenden Politiker in Deutschland.


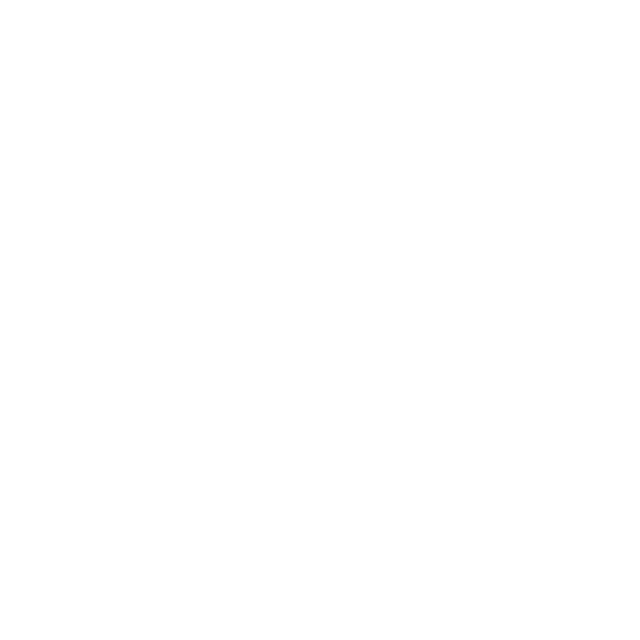
Treffend analysiert
Die Lösung ist so einfach wie effektiv: Schafft den Sozialstaat ab. Schnell!